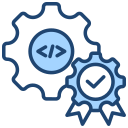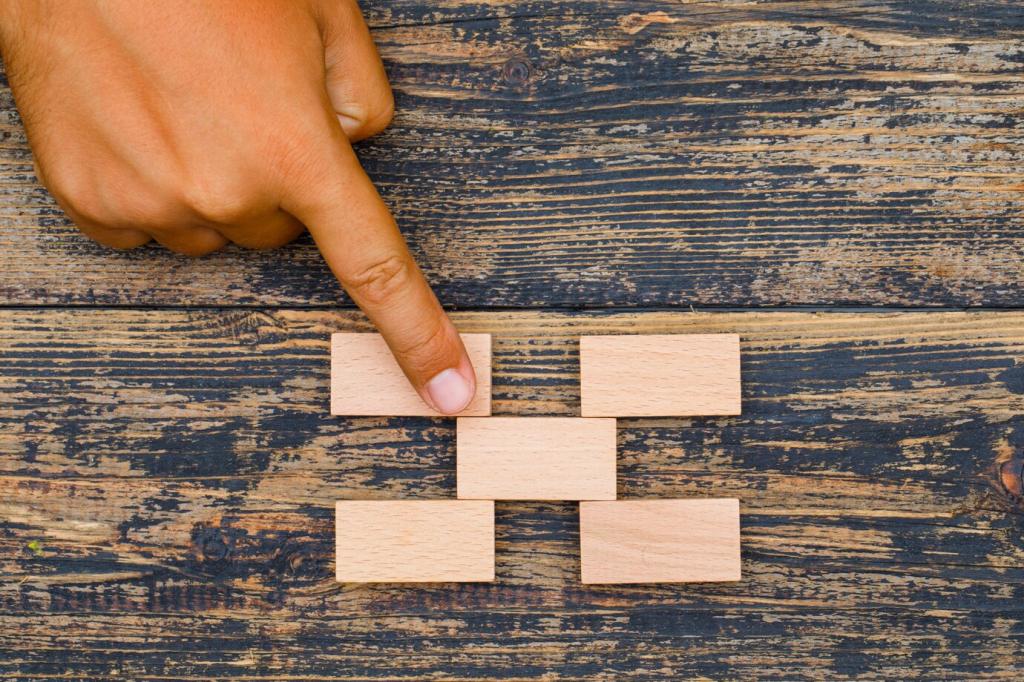Architektur, Governance und Integrationen
Low-Code punktet bei komplexen Integrationen, individuellen APIs und wiederverwendbaren Modulen. No-Code glänzt bei schnellen Connectoren zu Standarddiensten. Welche Integrationen sind für dich kritisch? Teile deinen Stack und erfahre, welche Muster sich bewährt haben.
Architektur, Governance und Integrationen
Versionierung, Tests, Freigaben und Monitoring sind in Low-Code-Plattformen oft detaillierter steuerbar. No-Code benötigt klare Policies, um Schatten-IT zu verhindern. Welche Kontrollmechanismen nutzt ihr heute? Diskutiere mit uns deine Release-Strategie und Audit-Tipps.